Gutes Hören und geistige Fitness im Alter gehen Hand in Hand. Diese Feststellung wird von einer aktuellen australischen Untersuchung untermauert, die dem Zusammenhang zwischen Hörschwächen und kognitiven Fähigkeiten in mehreren aktuellen Studien nachgeht. Zu den kognitiven Fähigkeiten zählen unter anderem Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Erinnerung, Orientierung und Kreativität. Die Ergebnisse zeigen eindeutig: Wer seine Hörschwäche mit Hörgeräten ausgleicht, kann dadurch nicht nur besser hören, sondern steigert auch seine Denkleistung.
Die Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) hat neue Zahlen zum Hörvermögen der Deutschen veröffentlicht. Auf ihrer Hörtour von März bis November letzten Jahres durch 321 deutsche Städte wurde das Gehör von 25.862 interessierten Teilnehmern aller Altersgruppen getestet.
Die Ergebnisse der FGH zeigen: Hörprobleme gibt es in jedem Alter.
Christian Dobel ist neuer Professor für Experimentelle Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Jena
Ein Psychologe in der HNO? Das sei durchaus naheliegend, erklärt Christian Dobel, der seit diesem Wintersemester die Professur für Experimentelle Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Jena innehat. „Denn viele Details der psychologischen Verarbeitung von Reizen, die wir insbesondere über das Gehör aufnehmen, sind noch nicht verstanden“, so der Psychologe.
Bild:Messungen im Biomagnetischen Zentrum des Uniklinikums Jena sind eine wichtige Methode in Christian Dobels (r.) Forschung, der die neue Professur für Experimentelle HNO-Wissenschaft innehat.
Schwerhörigkeit ist ein weltweites medizinisches Problem. Etwa 500 Mio. Menschen weltweit haben einen Hörverlust von mindestens 35 dB BEHL (best-ear hearing loss). Der Anteil der Menschen, die von Schwerhörigkeit in fortgeschrittenem Alter betroffen sind, ist hoch: mit 60 bzw. 70 Jahren ist jeder 5. bzw. jeder 3. mit >35 dB BEHL erheblich in seiner Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt (Stevens et al., Eur. J. Public Health 23, 2013). In der Regel stellen konventionelle Hörgeräte, die den ankommenden Schall verstärken und ins Ohr übertragen, die einzige Therapiemöglichkeit dar. Herkömmliche Hörgeräte stoßen oft aufgrund von Rückkopplungs- und Verzerrungseffekten oder mangelnder Leistung an ihre Grenzen, verursacht durch das relativ schlechte
Oldenburger Hörforscher ergründet Hörsystem von Heuschrecken
Nachts, wenn es ruhig ist, wirkt das Martinshorn eines Krankenwagens wie eine akustische Erschütterung. Am Tag, an einer verkehrsumtosten Straße, ist dasselbe Martinshorn lediglich eine Geräuschquelle unter vielen. „Adaptation“ nennen Forscher den Mechanismus, mit dem sich das Sinnessystem sowohl von Menschen als auch von Tieren an die Umgebung anpasst. Der Oldenburger Hörforscher Prof. Dr. Jannis Hildebrandt hat sich dem Phänomen gewidmet – und Neues über das Hörsystem von Grashüpfern herausgefunden. Seine in "PLOS Biology" publizierte Studie zeigt: Das Gehör von Grashüpfern justiert sich immer wieder neu, um die Gesänge der Artgenossen in verschiedenen Lärmwelten gut hören zu können.
Hörprozesse im Hirn
Die Nachwuchspreise 2015 der Leibniz-Gemeinschaft gehen an einen Wirtschaftswissenschaftler aus Kiel und eine Hirnforscherin aus Magdeburg
Auf ihrer Jahrestagung in Berlin hat die Leibniz-Gemeinschaft die herausragenden Doktorarbeiten des Wirtschaftswissenschaftlers Tobias Stöhr aus Kiel und der Neurobiologin Judith Mylius aus Magdeburg mit ihrem Nachwuchspreis ausgezeichnet. Die Arbeiten beschäftigen sich mit sozialen und wirtschaftlichen Aspekten der internationalen Arbeitsmigration und dem Ablauf verschiedener Prozesse im Gehirn beim Hören.
Die Medizinische Hochschule Hannover informiert:
Es klingt nach Science-Fiction, ist aber bald Realität: Das Steuern von Hörimplantaten wie dem Cochlea-Implantat über Gedankenkontrolle. Mit diesem revolutionären Ansatz sind wir als HNO-Klinik mit unserem Exzellenzcluster Hearing4all bei der CeBIT 2016 am Gemeinschaftsstand des Landes Niedersachsen anzutreffen. Wir sehen uns dort vom 14. -18. März 2016!
Zum Thema:
Weiterlesen: Ein Ausblick: CeBIT 2016 - CI mit dem Gehirn steuern
Spitze Bemerkungen
Es sind nicht etwa Pappkartons voller Münzen und Geldscheine mit der Post unterwegs, wenn bei internationalen Finanztransaktionen „Rettungspakete geschnürt“ werden. Ein Topf ist nicht im Spiel, wenn „Ausgaben gedeckelt“ werden, und beim „Stopfen von Milliardenlöchern“ spielt weder Strumpfwolle eine Rolle noch Klempnerwerkzeug. Solche Redewendungen sind nicht wörtlich gemeint. Sie sollen vielmehr abstrakte Zusammenhänge mit konkreten, einfachen und allgemein bekannten Handlungen vergleichen und so anschaulich machen. Die Linguistin Dagmar Schmauks legt eine umfangreiche Sammlung und Analyse vor.
Weiterlesen: Wie der Tastsinn die Sprache beeinflusst und uns hilft, die Welt zu begreifen
Der Trend zur Individualisierung zeigt sich auch bei Medizinprodukten und ihrer Herstellung: Individuelle medizinische Erzeugnisse, wie maßgeschneiderte Implantate und Orthesen, sind die Zukunft der Medizintechnik. Ihre direkte Herstellung aus spezifischen Messdaten kann Teil der nächsten industriellen Revolution sein: der Additiven Fertigung von Produkten.
Fraunhofer Institut
Christiane Rathmann - Hochschule Esslingen
Diskriminierung hat viele Gesichter. Überall dort, wo einzelne Personen oder Gruppen benachteiligt oder herabgesetzt, verunglimpft oder ausgegrenzt werden, gilt es aufmerksam und hellhörig zu werden. An der Hochschule Esslingen wurde im Rahmen eines Praxisprojektes seit zwei Jahren dazu geforscht. Dabei stand die Schulsozialarbeit als Antidiskriminierungsinstrument im Fokus. Heute hat das Projektteam die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert, Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis vorgestellt und mögliche Schritte zur Umsetzung diskutiert.
Nervenfortsätze im Hörzentrum unterscheiden sich in ihrer Form, je nachdem, auf welche Tonhöhe sie spezialisiert sind und wie schnell sie Signale weitergeben.
Die reizleitenden Fortsätze von Neuronen, die Axone, sind im zentralen Nervensystem der Wirbeltiere (also auch des Menschen) in der Regel myelinisiert, das heißt durch Fettschichten bildende Gliazellen isoliert. Diese Isolierung wird nur an den regelmäßig entlang der Axone auftretenden sogenannten Ranvier-Schnürringen unterbrochen. Nur an diesen Stelle können elektrische Aktionspotenziale aufgebaut werden. Die Aktionspotenziale „springen“ sozusagen über die isolierten Bereiche (die sogenannten „Internodien)“ von Schnürring zu Schnürring.
Weiterlesen: Neurobiologie - Strukturelle Abstimmung der Axone beim Hören
 Erkenntnisse aus abgeschlossenem LOEWE-Projekt zum Hausnotruf fließen in Anschlussprojekt zu tragbaren Computersystemen für Babyboomer-Generation ein
Erkenntnisse aus abgeschlossenem LOEWE-Projekt zum Hausnotruf fließen in Anschlussprojekt zu tragbaren Computersystemen für Babyboomer-Generation ein
Zur Debatte um die Konsequenzen des Demografischen Wandels leistet Forschung an der Frankfurt University of Applied Sciences (FRA-UAS) ihre Beiträge. Der Anteil älterer und hochaltriger Menschen in Deutschland nimmt stetig zu; dementsprechend steigt die Zahl hilfe- und pflegebedürftiger Menschen an, die (meist kostenintensive) Unterstützung benötigen. Um die Autonomie älterer Menschen in ihrer vertrauten, häuslichen Umgebung so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, können sogenannte Altersgerechte Assistenzsysteme (AAL) einen wertvollen Beitrag leisten.
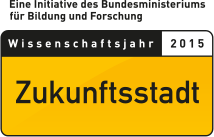 Wissenschaftsjahr 2015 - Zukunftsstadt
Wissenschaftsjahr 2015 - Zukunftsstadt
Im Wissenschaftsjahr Zukunftsstadt startet Mitmach-Aktion zur Stadtakustik / Wanka: „Geräusche haben großen Einfluss auf unser Wohlbefinden“
Berlin, 12.08.2015. Die Geräuschkulisse eines Ortes sollte stärker in der Stadtplanung berücksichtigt werden. Das wünscht sich mehr als jeder zweite Bundesbürger laut einer Umfrage, die forsa für das Bundesforschungsministerium im Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt durchgeführt hat. Dabei geht es den Bürgerinnen und Bürgern nicht allein um den Schutz vor Lärm, sondern auch um eine angenehme Geräuschkulisse in der Stadt.
- Das Fraunhofer Institut
- Barrierefreiheit im Studium: Automatische Spracherkennung verschriftet Vorlesungen in Echtzeit
- Podcast - Musik fürs CI
- Bildgebende Verfahren bei chronischen Schmerzen
- "Stammzellen geh\u00f6ren zu den gro\u00dfen Hoffnungen der Medizin"
- Töne mit Licht hören: eine Idee für Hörprothesen der Zukunft?


